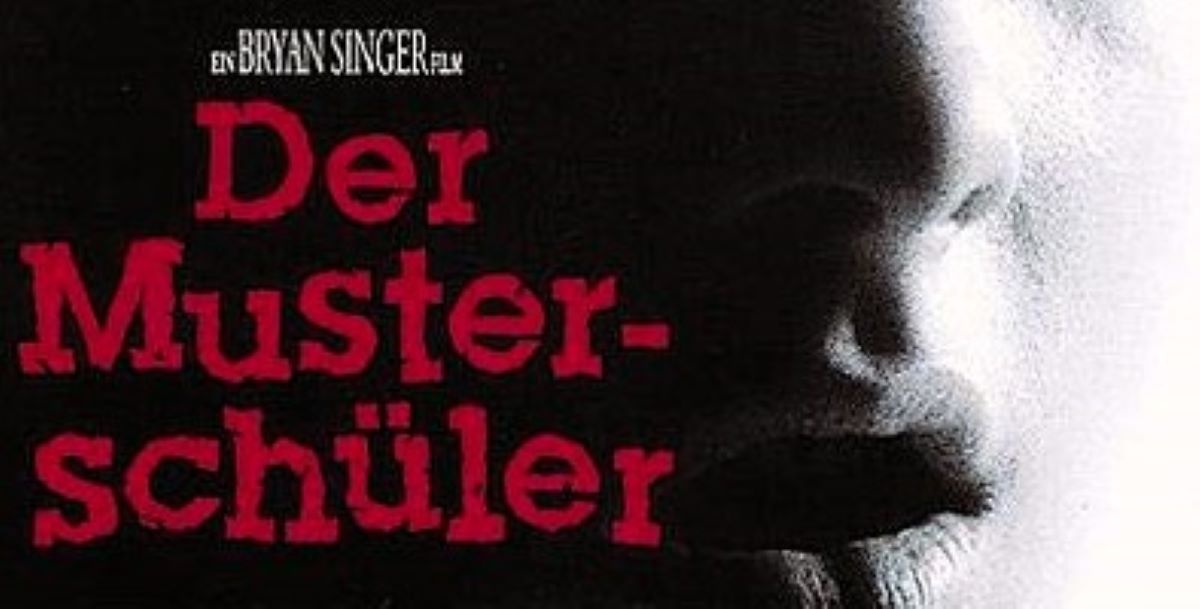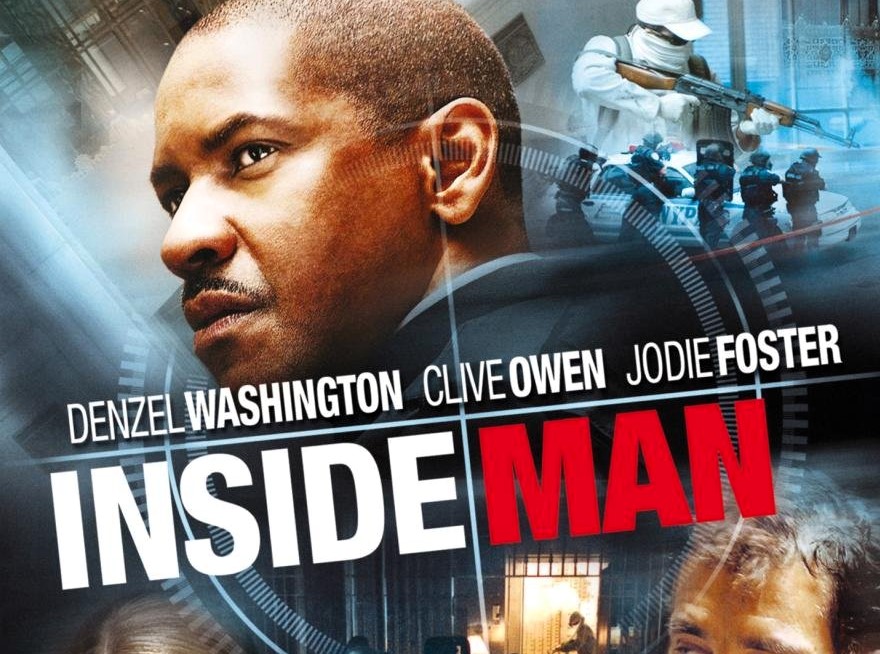-
Blind Side – Die große Chance
Inhalt Michael Oher – von allen nur “Big Mike” genannt – ist nicht gut in der Schule und sticht wegen seiner immensen Größe heraus. Eines Tages wird die Mutter eines Mitschülers auf den Koloss aufmerksam und nimmt ihn unter ihre Fitsche. Fortan werden dem unbeholfenen Jungen Förderungen zu Teil, seine Noten bessern sich und auch sein Talent auf dem Footballfeld bleibt nicht unentdeckt… Fazit Schon oft habe ich an dieser Stelle geschrieben, dass das Leben die besten Geschichten schreibt – und so auch wieder hier. Die Geschichte von Michael Oher wäre zwar auch findigen Drehbuchautoren zuzutrauen gewesen, doch dann hätte mich das Gezeigte wohl weniger beeindruckt und zu schnell als…
-
Jumanji
Inhalt Gemeinsam mit ihrer Tante ziehen zwei Waisenkinder in eine pompöse Villa ein und machen eine geheimnisvolle Entdeckung. Ihnen fällt das Brettspiel “Jumanji” in die Hände, aus dem kurz darauf eine lange verschollene Person entspringt… Fazit Die neuen “Jumanji”-Teile hat aufgrund ihrer veränderten Sichtweise und markanten Figuren wie “The Rock” durchaus ihren Reiz, doch es geht einfach nichts über das Original. Aus heutiger Sicht mögen die anfangs eher geruhsame Erzählweise und natürlich auch die angestaubte Technik ein kleiner Dorn im Auge sein, doch im Geschehen versunken gerät dies zur Nebensache. “Jumnaji” kam mit einer originellen Geschichte daher, die wohl nur auf das Jahr 1997 und seine technischen Möglichkeiten gewartet hat.…
-
Helix
Inhalt Ein hochrangiger Politiker bricht bei einer Rede zusammen und verstirbt kurz darauf an Ort und Stelle. Ermittlungen legen einen Anschlag mit einem speziell dafür geschaffenen Virus nah und die Polizei versucht so langsam Licht ins Dunkel zu bringen… Fazit Ab und zu durchstreife ich die Mediatheken und so wurde ich am vergangen Wochenende bei der ARD mit “Helix” fündig. Ein echtes Highlight war dieser Streifen sicherlich nicht, doch für einen entspannten Sonntagabend brauchte er eigentlich alles an Zutaten mit. Die Handlung wurde weitestgehend spannend und schlüssig präsentiert, auch wenn hier König Zufall ein großer Bestandteil des Storytellings ausmachte und das Treiben an vielen Stellen ordentlich zurechtkonstruiert wurde. Natürlich gab…
-
Hagen – Im Tal der Nibelungen
Inhalt Als Kind gelangte Hagen an den Hof von König Gunther und ist dort zu einem engen Vertrauten und Waffenmeister aufgestiegen. Er fühlt eine Zuneigung zu dessen Schwester Kriemhild, die durch den überraschenden Besuch von Drachentöter Siegfried und seiner Gefolgschaft auf eine harte Probe gestellt wird… Fazit Schon als kleiner Junge war ich von der “Nibelungen-Saga” schwer angetan, habe Filme und Bücher verschlungen, mich über den späteren Schulausflug nach Worms gefreut. Ebenfalls sehr gefreut habe ich mich nach den ersten, relativ verheißungsvollen Trailern auch auf dieses Werk – und wurde am Ende glücklicherweise nicht enttäuscht. Bereits nach wenigen Minuten zog dieser Streifen in seinen Bann und ließ mich bis zur…
-
Der Hooligan – Staffel 1
Inhalt Der junge Kuba ist frisch verliebt und tüftelt mit seiner Freundin einen riskanten Plan aus. Er arbeitet für einen Hooligan-Anführer als Drogenkurier und beginnt mit dem Abzwacken und anderweitigen Verticken der Ware. Als dieser Betrug auffliegt, stellen sich die eigenen Leute gegen ihn… Fazit Wenn es um das Thema “Hooligans” geht, bin ich eigentlich immer dabei – auch wenn ich mir für dieses Format einige Tage bis zur Sichtung gelassen habe. Erst habe ich ein wenig gehadert mit dem Beginn einer neuen Serie und habe die überschaubaren fünf Episoden in nur zwei Etappen durchgesuchtet. “Kibic” (so der Originaltitel) wirkte aus dem Leben gegriffen und beleuchtete die Motive seiner Figuren…
-
Bogotá: Stadt der Verlorenen
Inhalt Die Wirtschaftskriese im Jahr 1997 zwingt eine koreanische Familie zur Ausreise nach Kolumbien. Dort werden sie von einem alten Freund in Empfang genommen und finden schnell neue Arbeit. Das echte Paradies haben sie jedoch nicht gefunden, denn auch hier muss hart gehandelt und sich vor allem mit den korrupten Behörden arrangiert werden… Fazit Grundsätzlich erzählte “Bogotá” keine neue Geschichte und riss in keinem Bereich irgendwelche Bestmarken. Unterhalten hat der Streifen aber dennoch recht gut, auch wenn ab einem gewissen Punkt einige Schwächen im Drehbuch auftauchten und das Finale (keine Spoiler!) mit einigen Fragezeichen zurück ließ. Der Aufstieg unseres “Gangsterbosses” wurde gut verständlich und weitestgehend kurzweilig in Szene gesetzt. Es…
-
The Gorge
Inhalt Es gibt einen geheimnisvollen Spalt in der Erde, der auf zwei Seiten von Außenposten im Auge behalten wird. Jedes Jahr erfolgt eine Wachablösung, doch mit dem gegenüber stationierten Personal darf kein Austausch erfolgen. Aktuell sind Drasa und Levi mit dem Job betraut und entgegen der Bestimmungen freunden sich die Beiden über die Ferne miteinander an… Fazit Es gibt sie tatsächlich noch – die originellen Filme, bei denen mir selbst das Verfassen einer kurzen (und weitestgehend spoilerfreien) Inhaltsangabe schwierig fällt. Mit “The Gorge” hat Apple jedenfalls mal wieder einen richtigen Knaller im Sortiment, der in keine Schublade passt und auf seine Weise ein Lächeln auf die Lippen des Cineasten gezaubert…
-
Heartbreak Ridge
Inhalt Thomas Highway ist ein hoch dekorierter Soldat, aber auch ein Störenfried, der seine Gefühle nicht immer im Griff behält. Kurz vor seinem Ruhestand wird er noch einmal in die Heimat versetzt und soll dort eine Gruppe von Marines ausbilden. Für seine Vorgesetzten ist es eine Art von Beschäftigungstherapie, doch der ehrgeizige Highway will aus den Jungs wirklich harte Kerle formen… Fazit Seinerzeit war “Heartbreak Ridge” ein recht umstrittener Titel, der lange auf dem Index verweilte. Betrachtet man ihn allerdings mit heutigen Augen, lässt sich diese Einstufung kaum mehr nachvollziehen und die Enttäuschung könnte in einigen Bereichen durchaus groß sein. Eastwood glänzte mal wieder in der Rolle des knallharten Marines…
-
Humane
Inhalt In naher Zukunft hat der Klimawandel einen großen Teil der Bevölkerung reduziert und die verbleibenden Ressourcen sind knapp. Die Länder haben ihre Grenzen geschlossen und ihren Teil zur Lösung des Problems zugesagt. Ein besorgter Familienvater möchte nun seine Kinder über die Teilnahme an einem Euthanasie-Programm unterrichten, doch beim gemeinsamen Mahl kommt es zum Eklat… Fazit “Humane” stellt eine krasse, aber hierdurch interessante Prämisse auf und zieht den Zuschauer damit schnell in seinen Bann. Erwartet habe ich nach den ersten Bildern zwar einen Horrorfilm, doch dieser langsam aufdrehende Thriller bot trotzdem ein paar überängstliche Passagen. Die Inszenierung war nicht schlecht, trotzdem wirkte der Streifen durchwegs wie für ein für das…
-
Babygirl
Inhalt Sie ist hübsch, erfolgreich und führt auf den ersten Blick ein harmonisches Familienleben. Romy Miller ist da, wo viele Frauen gerne wären, doch mit Auftauchen eines neuen Praktikanten bringt sie die heile Welt selbst ins Bröckeln… Fazit Dank guter Promotion und dem Ausblick auf heiße Liebesszenen, hat “Babygirl” schon frühzeitig das Interesse geweckt und am Ende nur leidlich von sich überzeugen können. Es gab zwar ein paar relativ untypische und durchaus anregende Momente, dazwischen aber leider auch viele Leerläufe und keine befriedigende Botschaft mit dem Gang aus dem Kinosaal. Die Geschichte ist im Grunde sehr simpel und mit wenigen Wort ausformuliert. Man ahnt schnell, wohin die Reise geht und…