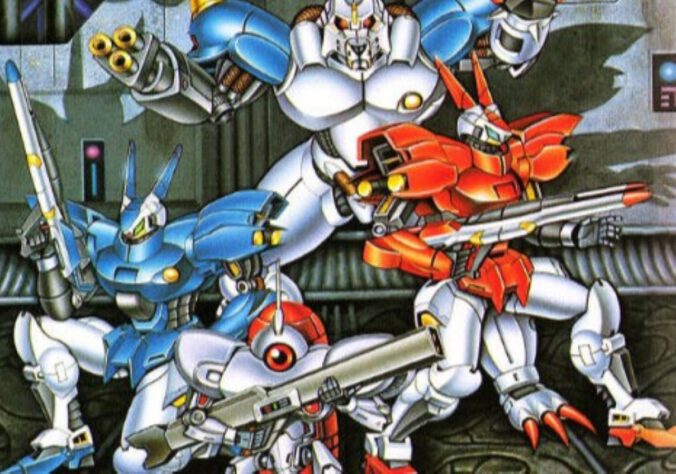Inhalt
Der Spieler schlüpft in die Haut eines Soldaten einer Sondereinheit und muss nach einem Virusausbruch auf dem Gelände der berüchtigten Area 51 für Ordnung sorgen…
Gameplay
„Area 51“ ist ein Lightgun-Shooter, der idealerweise auch mit selbiger zu bestreiten ist. Unsere Figur bewegt sich automatisch durch vorgerenderte Kulissen und uns bleibt lediglich die Kontrolle über das Zielkreuz und entsprechenden Abzugsfinger.
Die Gegner bestehen jedoch nicht nur aus Aliens, sondern auch aus mutierten Soldaten, die uns das Leben schwer machen. Entweder ballern wir direkt auf diese oder nutzen herumstehende Fässer oder aufgesammelte Granaten um der Lage wieder Herr zu werden.
Im Gegensatz zu anderen Titel haben die Macher hier auf digitalisierte Schauspieler gesetzt – was zwar einen realistischeren Look ergibt, jedoch auf Dinge wie unterschiedliche Trefferzonen verzichten lässt.
Spielzeit
Der Abspann ist bereits nach unter einer Stunde ersichtlich – was für ein Produkt dieser Art und Herkunft (Arcade) eine solide Spielzeit ist. Ihr könnt euch allerdings noch am Auffinden versteckter Räume oder in einem kleinen Trainings-Areal zusätzlich beschäftigen.
Präsentation
Optisch ist der Titel natürlich wieder ein Kind seiner Zeit und kann nicht nach heutigen Maßstäben bewertet werden. Damals waren die gerenderten Hintergründe recht passabel gestaltet, die scheinbar gefilmten und digitalisierten Figuren ganz witzig gestaltet und vor allem nett animiert. Besonders die Waffeneffekte wirkten zwar etwas billig, aber insgesamt passte dies zum angenehm trashigen Gesamtbild mit ganz viel B-Movie-Flair.
Der Soundtrack war unspektakulär, passte aber ebenfalls zum Rest und störte nicht großartig.
Positiv
- launiges Gunplay
- angenehm simples Gameplay
- trashiges Flair
- stellenweise echt filmreife Inszenierung
Neutral
- kurze Spielzeit
- Technik altbacken
Negativ
- keine unterschiedlichen Waffen
- ein paar leicht unfaire Passagen
- niedriger Wiederspielwert
Fazit
Wer sich genug in „House of the Dead“ oder „Virtua Cop“ ausgetobt hat, darf auch „Area 51“ mal eine Chance geben. Das Spiel bereichert das Genre zwar um keine neuen Impulse, performt aber durchwegs solide und macht irgendwo schon Spaß.
Wer Futter für seine Lightgun sucht und die höherwertige Konkurrenz schon lange abgefrühstückt hat, darf also gerne mal einen Blick wagen und sich entspannt durch schauerlich-schön animierte Feindeshorden ballern.
Grafik: 6,5/10
Sound: 6/10
Gameplay: 4/10
Gesamt: 6/10
Fotocopyright: Midway