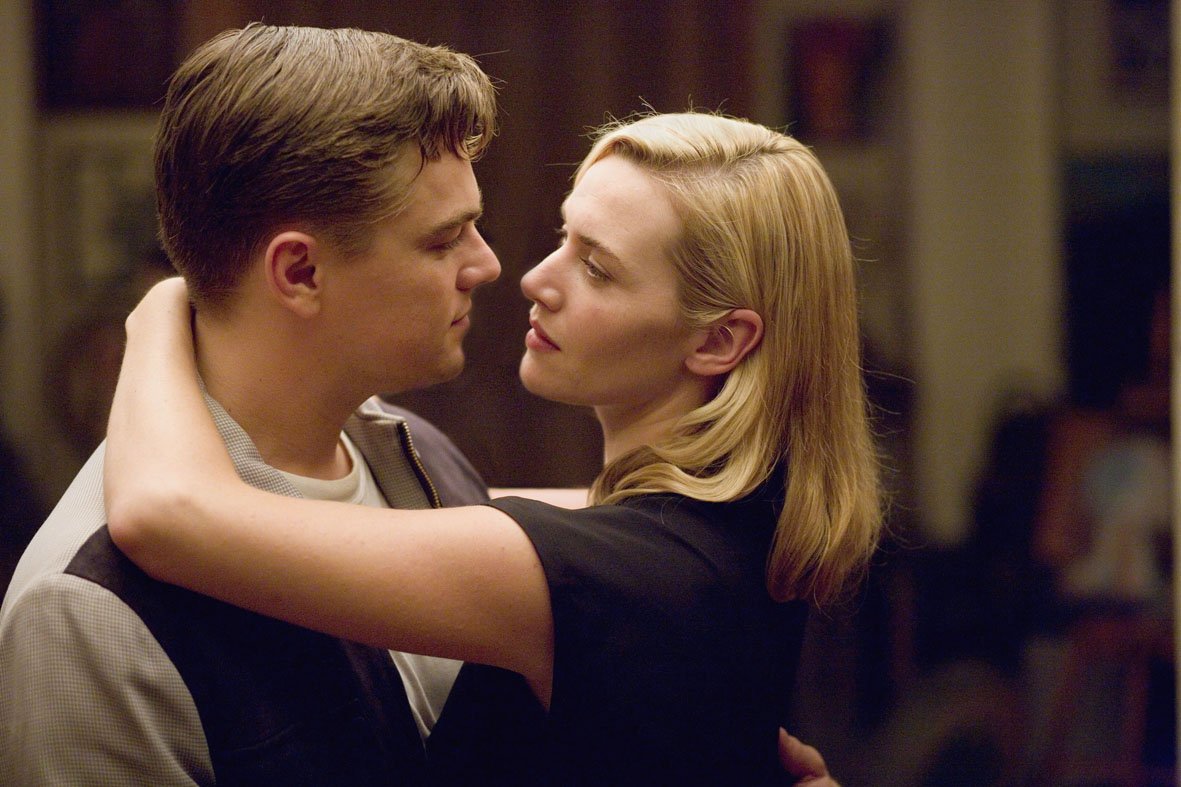-
Perfekt Verpasst – Staffel 1
Inhalt Maria und Ralf sind mehr oder weniger Single, leben in der selben Stadt, haben einen sich überschneidenden Freundeskreis, doch haben sich bis dato noch nicht persönlich getroffen. Obwohl die Beiden eigentlich prima zueinander passen würden und es von den Bekannten durchaus einige Verkuppelungsversuche gibt, verpassen sie sich immer ganz knapp… Fazit Mit dieser Serie hat Amazon bei mir echt für Freude gesorgt. Engelke und Pastewka gehen eigentlich immer – und wenn beide Comedians dann auch noch zusammen in einer Produktion aufeinandertreffen, konnte nur Gutes dabei herumkommen. Zunächst sei gesagt, dass “Aufeinandertreffen” hier eher nicht das Hauptthema ist – schließlich verpassen sich unsere beiden Akteure immer ganz knapp und haben…
-
Nightwatch: Demons Are Forever
Inhalt 30 Jahre sind vergangen und noch immer sind die damaligen Ereignisse nicht vollständig verarbeitet. Obwohl die Mutter Selbstmord beging und der Vater noch immer von Alpträumen begleitet wird, nimmt Tochter Emma ebenfalls den Job als Nachtwächterin in der Leichenhalle der Universität an. Es ist ihre Art den Dämonen der Familie zu begegnen, vor allem aber auch weitere Nachforschungen zum damaligen Täter anzustellen und dabei auf böse Überraschungen zu stoßen… Fazit Es ist nicht vielen Regisseuren vergönnt, ein Remake von ihrem eigenen Original zu drehen – doch Ole Bornedal wurde diese Ehre einst berechtigterweise zu Teil. “Nightwatch” (oder später auch “Freeze”) war ein schöner kleiner Schocker, der mit einfachen Mitteln…
-
Ein Jackpot zum Sterben
Inhalt In naher Zukunft ist die Lotterie in Los Angeles tatsächlich zu einem harten Kampf ums Überlegen geworden. Nach erfolgreicher Ziehung muss der potentielle Gewinner bis zur Abenddämmerung ausharren, wird dabei aber von Kameras und anderen Teilnehmern verfolgt. Diese wollen natürlich allesamt Blut sehen und sich das begehrte Siegerlos schnappen. Mitten in diese Wirren gerät eine junge Dame, die eigentlich nur für ein Casting vorsprechen wollte… Fazit Es gibt gute und schlechte Ideen für einen Film und die Prämisse von “Jackpot” liegt irgendwo dazwischen. Die Handlung orientiert sich irgendwo bei “Running Man” und Konsorten, versuchte sich aber mit viel Witz von der Konkurrenz abzuheben – was am Ende nur mäßig…
-
Der Illusionist
Inhalt Anfang des 20igsten Jahrhunderts. In der Stadt Wien sorgt Magier Eisenheim für ein staunendes Publikum und entsprechend gefüllte Säle. Die Konkurrenz ist nicht in der Lage seine Tricks zu durchschauen und die Ordnungshüter sind gegenüber den Illusionen äußerst skeptisch und vermuten einen Betrug. Zu eskalieren scheint die Lage allerdings, als sich unser Künstler den Kronprinzen persönlich zum Feind auserwählt… Fazit Manche Filme schlummern gefühlt ewig in der Sammlung und teilweise denkt man selbst, dass man sich schon gesehen hätte. Vermutlich habe ich diesen Titel aufgrund seiner deutlichen Parallelen im Kopf stets mit “The Prestige” in Zusammenhang gebracht – und ihn nun nach Jahren tatsächlich zum ersten Mal auf dem…
-
Blue Giant
Inhalt Ein junger Mann reist vom beschaulichen Land in die pulsierende Metropole Tokio. Hier möchte er unbedingt als Jazz-Musiker durchstarten, doch aller Anfang ist schwer. Er schart ein paar Bandkollegen um sich und versucht in diversen Clubs ein paar Auftritte zu erhalten… Fazit Anime und Jazz sind im Grunde eine gute Kombination – sofern man mit beiden Bestandteilen etwas anfangen kann. Auf mich trifft das mit dem Musikstil zwar weniger zu, doch unterhaltsamen Zeichentrickfilmen bin ich trotzdem nie abgeneigt. “Blue Gigant” erzählte eine nette, aber weitestgehend spannungsfreie und vorherschaubare Geschichte. Alles lief nach erwarteten Parametern ab und echte Überraschungen gab es dabei eigentlich nicht – was glücklicherweise dank geschmeidigen Verlauf…
-
Alpha Dog
Inhalt Der Streit zwischen zwei rivalisierenden Kleinkriminellen eskaliert und mündet in einer mehr oder weniger spontanen Entführung. Die Entführer wissen allerdings nicht so recht, was sie nun mit ihrer Geisel anfangen sollen und häufen eine Menge an Zeugen für ihre Straftat an… Fazit Das Leben schreibt manchmal die besten Geschichten, aber so nicht unbedingt hier. Die Handlung von “Alpha Dog” hatte zwar ihre guten Momente, doch insgesamt verlief das Geschehen doch recht vorherschaubar und grade zum Finale hin verzettelten sich die Autoren ein wenig. Man baute eine solide Spannungskurve, um sie dann mit kleineren Ungereimtheiten spürbar zu demontieren. Auch wenn die tatsächlichen Ereignisse so ungefähr wie im Film stattgefunden haben,…
-
Lolita (1997)
Inhalt Ende der 40iger Jahre. Der französische Professor Humbert reist nach Amerika, um dort zu unterrichten und an weiteren Büchern zu arbeiten. Nachdem er das niedergebrannte Haus seiner Gastfamilie vorfindet, erhält er zum Glück Unterschlupf bei einer hilfsbereiten Frau und deren Tochter Dolly. Je länger er sich allerdings bei ihnen aufhält, desto hingezogener fühlt er sich zur kleinen Dame – die er liebevoll Lolita nennt… Fazit Damals wie heute ist “Lolita” kein leichter Stoff und der Name steht als Sinnbild für eine verbotene Romanze. Die Adaption von 1997 jedoch entspricht einem eher normalen amerikanischen Kinofilm und gab sich trotz hoher Freigabe (wohl eher aufgrund der allgemeinen Thematik) vergleichsweise harmlos. Der…
-
Love is all around (Switch)
Inhalt Der Spieler schlüpft in die Haut eines jungen Mannes, der gerade seine Wohnung verloren hat. Nun muss er sich entscheiden, bei welcher seiner weiblichen Bekanntschaften Unterschlupf findet und ob er möglicherweise auch eine Beziehung mit ihr eingeht… Gameplay “Love is all around” ist quasi eine Dating-Simulation, die in Form eines interaktiven Filmes daher kommt. Das Spiel besteht komplett aus Videos (bzw. auch gerenderten Standbildern hieraus) und läuft weitestgehend von allein ab. An bestimmten Stellen dürfen wir die Handlung mit einfachen Entscheidungen beeinflussen und ändern so die Beziehungen der Figuren untereinander. Am Ende eines Kapitels werden diese “Emotionen” bewertet und ihr müsst stets genügend Punkte erarbeitet haben, damit die Story…
-
No Return (PC)
Inhalt “No Return” versetzt den Spieler in eine Wohnung, von der aus er immer wieder den Fahrstuhl zu einem unterem Stockwerk nimmt und dort auf unterschiedliche Weise mit Ereignissen aus der Vergangenheit konfrontiert wird… Gameplay “No Return” ist ein Gruselspiel, welches vom Gameplay her definitiv an meine allseits geliebten “Walking Simulatoren” erinnert. Wir marschieren im gemächlichen Tempo durch ähnliche, aber immer wieder leicht variabel gestalteten Areale und müssen dort verschiedene Gegenstände finden und miteinander kombinieren. Am Ende öffnet sich dann eine Tür und dann beginnt der Ablauf wieder von Vorne. Im Gegensatz zu vielen Mitstreitern können wir im gemächlichen Abklappern der Locations jedoch auch sterben – beispielsweise wenn uns eine…
-
“O – Vertrauen, Verführung, Verrat”
Inhalt Odin James ist der Star im Basketball-Team und vor allem seinem Mitschüler Hugo ein großer Dorn im Auge. Hugos Vater trainiert das Team und greift hart durch. Mit allen Mitteln möchte sein Sohn jedoch auch einmal im Rampenlicht stehen und scheint dabei sogar über Leichen gehen zu wollen… Fazit “Othello” ist mir zwar von Namen ein Begriff, doch mit der Handlung habe ich mich bis dato noch nicht wirklich auseinandergesetzt. Ähnlich wie Romeo & Julia hatte man die Sache anno 2001 mit angesagten Darstellern zwar in die Moderne versetzt, auf den Gebrauch der altertümlichen Sprache jedoch verzichtet. Auch wenn ich nun keine direkten Parallelen zur Vorlage ziehen kann, war…