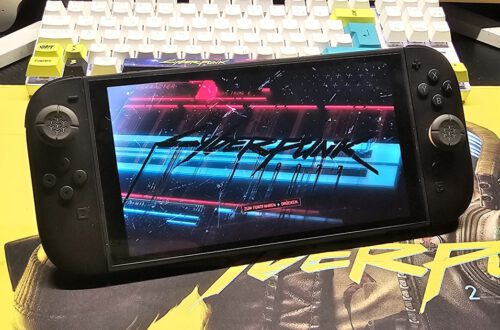-
Anker Soundcore SpaceOne Bluetooth Kopfhörer im Kurztest
Einleitung Obwohl mich Anker mit den Soundcore Q30 und Q45 enttäuscht hat, wollte ich den SpaceOne trotzdem eine Chance einräumen. Meine geliebten Bang & Olufsen leiden zunehmend unter Verbindungsproblemen und der Akku der Soundcore Q20 nähert sich dem Ende – also mussten neue Begleiter für den täglich Weg zur Arbeit her. Lieferumfang, Optik & Haptik Im Gegensatz zu den Vorgängern kommen die SpaceOne zwar weiterhin mit einem USB-C-Ladekabel, aber ohne Transportcase daher. Stattdessen hat uns der Hersteller einen schicken Beutel dazu gepackt, dessen Schutzfunktion aber mal dahingestellt sei. Die weißen Q45 haben mir von der Optik extrem gut gefallen, was ich von den hellen SpaceOne nur bedingt behaupten kann. Das…
-
Trigger Warning
Inhalt Parker ist Soldatin mit Herz und Seele. Als sie von dem Tod ihres Vaters erfährt, kehrt sie in die alte Heimat zurück. Eigentlich war kein großer Aufenthalt geplant, doch ein paar Unstimmigkeiten bewegen sie zur Recherche. Möglicherweise fiel der alte Herr keinem Unglück, sondern einem Mordkomplott zum Opfer… Fazit Mit Jessica Alba holt Netflix mal wieder ein bekanntes Gesicht zurück auf die Bühne und liefert mit “Trigger Warning” zumindest einen soliden Snack für die Zeit zwischen den Spielen der Fußball-Europameisterschaft ab. Mit der Handlung (und deren gesamten Verlauf) war sicherlich kein Blumentopf mehr zu gewinnen und auch die CGI-Effekte waren nicht mehr “State-of-the-Art”, aber immerhin war ein gewisser Unterhaltungswert…
-
Die Vorahnung
Inhalt Linda Hanson ist Mutter zweiter Kinder und glücklich mit ihrem Mann Jim verheiratet. Als er eines Tages auf dem Weg zu einem Geschäftstermin tödlich verunglückt, bricht die heile Welt zusammen und tiefe Trauer ist angesagt. Sie staunt jedoch nicht schlecht, als Jim am einem Morgen plötzlich wieder seelenruhig am Frühstückstisch sitzt und so tut, als ob nichts geschehen wäre… Fazit “Die Vorahnung” ist ein Film, auf den man sich einlassen muss. Seine Handlung mag sicherlich an den Haaren herbei gezogen worden sein und ein paar mehr oder minder große Logiklücken aufweisen, doch am Ende blieb zweifelsohne eine akzeptable Aussage und vor allem eine bis dato recht passable Unterhaltung ohne…
-
Roseland Soundbar vom Action im Kurzcheck
Einleitung Die Samsung Q900-Soundbar ist mittlerweile mitsamt Subwoofer und Rear-Speakern ins Schlafzimmer gewandert und der gute alte Marantz hat mit neuen Lautsprechern wieder seinen Betrieb im Wohnzimmer aufgenommen. Mit dieser Konstellation bin ich zwar durchaus zufrieden, jedoch ist der “Spieltrieb” mit neuer Hardware damit nicht überwunden. Um bei einfachen TV-Sendungen nicht die stromfressende Anlage einschalten zu müssen, wollte ich mich mal bei (ganz) kleinen Soundbars umschauen und bin bei den letzten Wochenangeboten im Action fündig geworden. Lieferumfang & erster Eindruck Die Soundbar kommt in einem recht ansprechenden Karton daher und überrascht mit geringen Gewicht. Im Lieferumfang ist neben einer Fernbedienung (sogar mit Batterien!), dem Netzteil, auch ein HDMI-, ein optisches…
-
Still Wakes the Deep (PC)
Inhalt Der Spieler schlüpft in die Haut von Caz McLear, der vor privaten Problemen wegrennt und auf einer Bohrplattform als Elektriker untergekommen ist. Kurz nachdem er von seinem cholerischen Chef gefeuert wurde, spielen sich seltsame Dinge auf dem ungewöhnlichen Arbeitsplatz im Meer ab… Gameplay Die Programmierer von The Chinese Room haben mit der “Anmesia”-Reihe bereits Erfahrungen gesammelt und sind dem Genre treu geblieben. “Still Wakes the Deep” ist ein Horror-Adventure aus der Ego-Perspektive und setzt in erster Linie auf eine beklemmende Atmosphäre, denn auf Kämpfe oder gar lautes Geballer. Wir bewegen unsere Spielfigur durch verschiedene Abschnitte der Bohrinsel, versuchen dabei anderen Kollegen zu helfen und irgendwie eine Fluchtmöglichkeit zu finden.…
-
Zum Mars oder zu Dir?
Inhalt Seit dem Tod seines Bruders ist Alex McAllister etwas in sich gekehrt und in seinen Träumen vom Weltall versunken. Er hat kein Interesse das Geschäft des Vaters zu übernehmen und bewirbt sich bei einem Programm zur Kolonialisierung des Planeten Mars. Als er hierfür ausgewählt wird und erste Reporter auftauchen, wird der Familie so langsam bewusst, dass Ihr Sohn sie mit einem One-Way-Ticket verlassen wird… Fazit So grundsätzlich hat mich die Prämisse des Filmes schon angesprochen, doch leider hat mich der Verlauf beim Anschauen nicht sonderlich überrascht. Die kurze Inhaltsangabe und der (viel zu ausführliche) Trailer haben im Prinzip schon alles vorweg genommen und nur wenig Raum für Variationen geboten.…
-
Monolith (Nintendo Switch)
Inhalt Der Spieler schlüpft in die Rolle von Tessa Carter, die gerade mit ihrem Raumschiff abgestürzt und noch leicht benebelt in der Kälte-Schlafkammer erwacht. Nun gilt es zu klären, wo sie sich grade befindet und vor allem wo ihr Begleiter Mark steckt… Gameplay “Monolith” ist ein Point-and-Click-Adventure der alten Schule und definiert hieraus auch seine Zielgruppe. Wer bisher mit dem Genre nichts anfangen kann, bleibt Außen vor – wer Titel im Stil der alten Lucas-Arts Klassiker mag, reibt sich freudig die Hände. Ihr steuert die Spielfigur nicht direkt, sondern klickt dorthin, wohin sie sich bewegen soll. Auf Knopfdruck werden Hotspots für mögliche Interaktionen eingeblendet, ebenso euer Inventar, wo ihr Gegenstände…
-
Die Vergessenen
Inhalt Vor Monaten hat Alice ihren Sohn bei einem Flugzeugabsturz verloren und seitdem befindet sie sich in tiefer Trauer. Sie geht regelmäßig zur Therapie, doch die Stunden mit dem engagierten Doc helfen nur bedingt weiter. Physisch baut sie immer mehr ab, vergisst kleinere Dinge und scheint völlig neben sich zu stehen. Es geht sogar so weit, dass ihre Umgebung daran zweifelt, dass sie wirklich mal ein Kind gehabt hätte… Fazit Ich habe es schon bei einem letzten Review geschrieben und kann mich an dieser Stelle einfach nur wiederholen. Manchmal lohnt sich ein Blick in die Mediatheken, um entweder interessante Fernsehbeiträge – oder wie in diesem Fall – vergleichsweise rare Filme…
-
Imaginary
Inhalt Mit dem Einzug in das Elternhaus beginnt für Jessica und ihre Familie ein neuer Lebensabschnitt. Während die Erwachsenen mit dem Einrichten beschäftigt sind, findet Tochter Alice im Keller einen alten Teddybären und gibt ihn fortan nicht mehr aus der Hand. Am Anfang belächelt Jessica die innige Bindung zu dem neuen Plüschtier, doch schon bald nimmt die neue Liebe seltsame Züge an… Fazit Ein nettes Coverbild und das Blumhouse-Logo ließen mich freudig auf diesen Film einstimmen, doch die Freude währte nur von kurzer Dauer. Zwar habe ich beim kurzen Überfliegen der Inhaltsangabe kein Innovationswunder erwartet, mich dennoch auf einen unterhaltsamen Grusel gefreut. War man zu Beginn auch noch frohes Mutes,…
-
Titanfall 2 (XBOX One/PC)
Inhalt Der Spieler schlüpft in die Haut von Jack Cooper, der als einfacher Soldat im Krieg von großen Konzernen verwickelt wird und inmitten der Gefechte auf den Mech BT stößt und unverhofft zu dessen Piloten wird… Gameplay War der erste Teil noch ein reiner Multiplayer-Shooter, hat man den zweiten Teil um eine tolle Singleplayer-Kampagne erweitert, die ich in diesem Review etwas genauer besprechen möchte. Wie schon beim Erstling handelt es sich auch beim Nachfolger um einen First-Person-Shooter, der nicht nur zu Fuß, sondern auch innerhalb eines Mechs bestritten werden kann. Neben heftigen Gefechten stehen aber auch kleinere Geschicklichkeitstests wie wilde Sprungpassagen oder dem Hantieren mit kleineren Zeitreisen auf der Tagesordnung.…