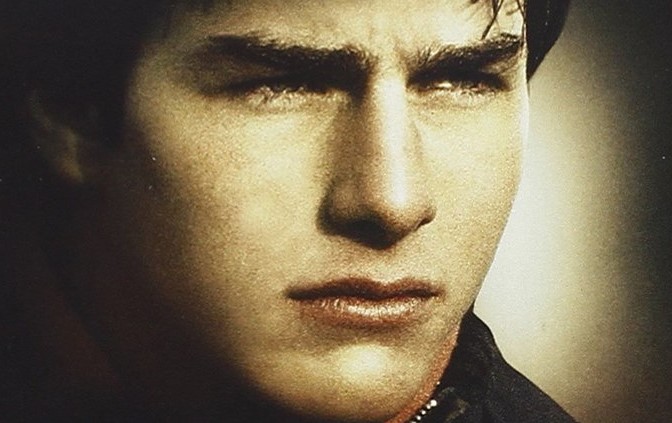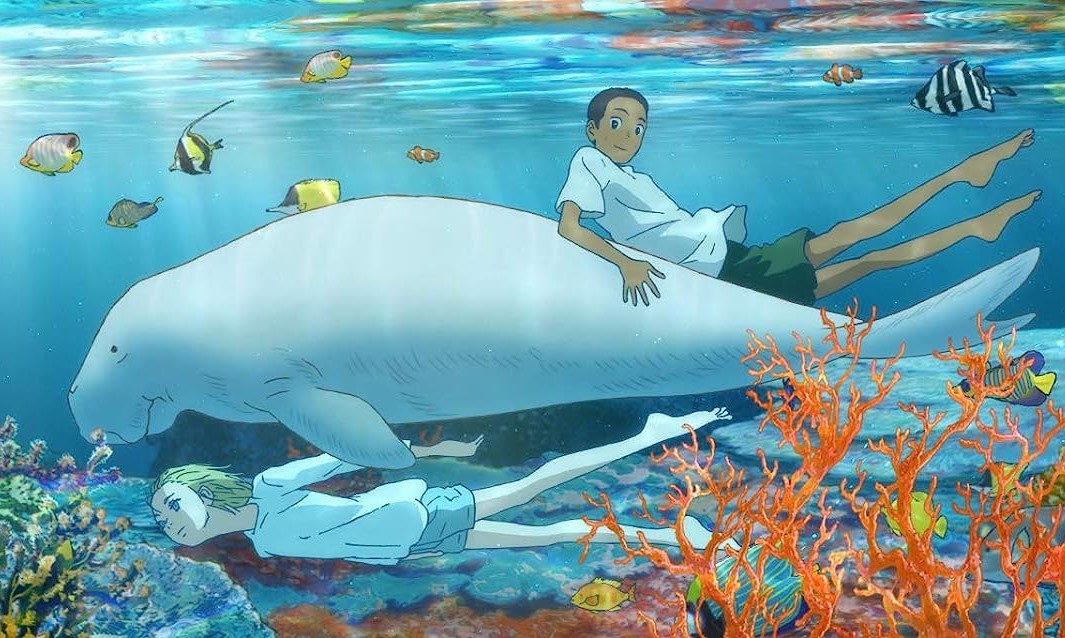-
The Tag – Along 1
Inhalt Die Beziehung eines jungen Pärchens wird auf eine harte Probe gestellt. Erst gibt es Diskussionen um Hochzeit und Nachwuchs, dann verschwindet auch noch die Großmutter des Mannes spurlos. Scheinbar sind sie damit nicht allein, denn plötzlich werden immer mehr Personen aus ihrem Stadtteil in Taiwan vermisst… Fazit Asiatische Geistergeschichten sind immer eine Sache für sich, doch trotz relativ überschaubarer Erklärungen konnte man dem Treiben hier recht gut folgen und sich sogar eigene Theorien zu den Tathergängen machen. Die Erzählung war dabei überwiegend ruhig, aber etwas stimmig. Es gab wenige Figuren, nur eine Handvoll an Schauplätzen und erstaunlich wenige Effekte – doch allein mit seiner tollen Soundkulisse wurde für mächtig…
-
Afterburn
Inhalt Eine gewaltige Sonnen-Eruption hat die Menschheit fast ins das Mittelalter zurück katapultiert. Die Technik ist ausgefallen, Regierungen gestürzt, Überlebende haben eigene Königreiche gebildet und Anhänger um sich geschart. Inmitten dieser Wirren agiert Jake als eine Art von Schatzsucher, der gegen Bezahlung seine Dienste anbietet. Sein aktueller Auftrag besteht nun darin, die Mona-Lisa in den Überresten Frankreichs aufzutreiben… Fazit Der Trailer versprach sinnfreie, aber kurzweilige Unterhaltung und das fertige Produkt konnte diesen Erwartungen standhalten. Streng genommen war “Afterburn” kein wirklich guter Film, aber seine lockere Machart, lustige Darsteller und seine schöne Action sorgten für gute Laune. Die Geschichte war nicht neu und das Endzeit-Szenario auch nur bedingt überzeugt, bei den…
-
Die große Flut
Inhalt Eine riesige Flutwelle überschwemmt das Land und rast auf den Wohnblock einer Wissenschaftlerin zu – die in voller Panik versucht, sich und ihren Sohn zu retten. Sie versuchen das rettende Dach des Gebäudes zu erreichen und erhalten dabei Unterstützung von einem mysteriösen Fremden, der scheinbar mit falschen Karten spielt und sich der Identität seiner “Mandantin” bewusst ist… Fazit Optisch famos und inhaltlich zumindest am Anfang noch relativ spannend. Mit “Die große Flut” hat Netflix einen interessanten, zum Ende hin allerdings auch recht verwirrenden Titel aus Südkorea am Start und mein Fazit fällt durchwachsen aus. Es hätte so schön werden können. Der Film steigt relativ früh ins nasse Geschehen ein…
-
Restart the Earth
Inhalt In naher Zukunft haben sich die Menschen selbst in Bedrängnis gebracht. Eigentlich wollte man nur ein vermehrtes Wachstum in Wüstenregionen erzwingen, doch stattdessen haben sich Pflanzen auf der ganzen Welt ausgebreitet, an Intelligenz gewonnen und quasi die Herrschaft über den Planten übernommen. Eine Truppe von Soldaten versucht diesen Prozess rückgängig zu machen, doch die nächste Evolutionsstufe der grünen Flut steht bereits vor der Tür… Fazit Mit nur einen kurzen Intro werfen uns die Chinesen hier direkt ins Geschehen – und das war auch gut so. “Restart the Earth” konnte bei einigen Effekten nicht ganz von sich überzeugen, gefiel aber mit einem durchwegs hohen Erzähltempo und ließ uns während seiner…
-
The Protege – Made for Revenge
Inhalt Anna ist Auftragskillerin und kennt keine Furcht. Als eines Tages ihr Ziehvater und eine andere nahestehende Person ermordet wird, schwört sie unerbittliche Rache. Allerdings muss sie erst einmal herausfinden, wer die Täter waren und vielleicht auch welches Motiv hinter dieser Aktion war… Fazit Für mich war “The Protege – Made for Revenge” in erster Linie eine beeindruckende “Techdemo” von Maggie Q, die sich hier auf der einen Seite äußerst sexy und attraktiv, auf der anderen Seite allerdings auch als äußerst wandlungsfähig und schlagfertig präsentierte. Über weite Teile trug die Akteurin das Werk von ganz allein, ließ ihre etablierten Kollegen wie Samuel L. Jackson oder Michael Keaton ganz schön alt…
-
Revelations
Inhalt Der Pfarrer einer Freikirche begeht einen großen Fehler. Nach dem Verschwinden seines Kindes heftet er sich an die Fersen eines Sexualstraftäters und lässt sich zu einer unüberlegten Aktion hinleiten… Fazit Obwohl die Koreaner mit der Kirche gar nicht so viel am Hut haben, folgt nach “The Divine Fury” schon gleich der nächste Streifen in dieser Woche, der zumindest eine Bezüge hierzu herstellt. Was mit “Revelations” aber auf jeden Fall gelang, war die Ablieferung eines grundsoliden Thrillers, bei dem man sich genüsslich zurücklehnen und der spannenden Dinge folgen konnte. Der Film besaß einen schönen Spannungsaufbau und gefiel hierfür mit düsteren, verregneten und dennoch auf Hochglanz polierten Bildern. Die Inszenierung war…
-
House at the End of the Street
Inhalt Um nach der Scheidung ein neues Leben zu beginnen, ziehen Elissa und ihre Mutter in ein recht preiswertes Häuschen in einer kleinen Stadt. Über den ungewöhnlich niedrigen Preis wundern sie sich zunächst, erfahren jedoch schnell den Grund dafür: In der Nachbarschaft wurden vor einigen Jahren zwei Menschen von ihrer geistig verwirrten Tochter ermordet. Der überlebende Sohn lebt noch immer allein in dem Haus und wird von den übrigen Einwohnern gemieden. Einzig Elissa geht unvoreingenommen an die Sache heran und freundet sich mit dem seltsam schüchternen Jungen an … Fazit Nach ihrem endgültigen Durchbruch mit Die Tribute von Panem – The Hunger Games und dem Gewinn des Oscars ist Jennifer…
-
The Beast and the Beauty – Das Biest und die Schöne
Inhalt Hae-ju Jang ist ein blindes Mädchen, führt jedoch nicht zuletzt durch ihren Freund Dong-geon ein erfülltes Leben. Die beiden lernen sich zufällig kennen und werden schnell zu engen Freunden. Viele Stunden verbringen sie miteinander, und alles scheint harmonisch und glücklich. Hae-ju Jang ahnt jedoch nicht, dass Dong-geon nicht dem Bild eines klassischen Prinzen entspricht. Eine Narbe auf der Stirn zeichnet ihn, und auch sonst ist er alles andere als ein Frauenheld. Für beide stellt dies zunächst kein Problem dar – bis Hae-ju Jang kurz vor einer Operation steht, die ihr das Augenlicht schenken soll. Aus Scham über seine selbst eingeredete Hässlichkeit gibt sich Dong-geon plötzlich für einen anderen aus…
-
Oldboy
Inhalt Oh Dae-Su wird von Unbekannten scheinbar grundlos entführt und in einem Zimmer eingesperrt. Er hat keinen Schimmer, wer ihm dies angetan hat, und verbringt seine Tage einsam in einer trostlosen Umgebung. Sein Essen wird ihm geliefert, sogar sein Zimmer wird gereinigt – während er betäubt auf dem Boden liegt. Tag für Tag wächst sein Hass, und er beginnt zu trainieren. Eines Tages, nach nunmehr 15 Jahren, ist er plötzlich frei. Nun scheint die Zeit für Vergeltung gekommen zu sein, und er begibt sich auf die Suche nach seinen Peinigern. Doch die eigentliche Geschichte fängt gerade erst an … Fazit Oldboy überzeugt von Anfang an durch seinen gelungenen Spannungsaufbau. Die…
-
Friend
Inhalt Friend erzählt die Geschichte von vier Freunden aus Korea und davon, wie sie sich im Laufe der Jahre verändern. Wir lernen die Protagonisten zunächst als unbedarfte Kinder kennen, erleben ihre problematische Schulzeit und erkennen, wie stark ihre späteren Lebenswege bereits durch das Elternhaus geprägt werden. Mit zunehmendem Alter brechen die Kontakte ab, doch nach vielen Jahren kreuzen sich ihre Wege erneut. Ein Teil der Freunde hat sich dem kriminellen Milieu angeschlossen – allerdings stehen sie selbst dort nicht auf derselben Seite. Trotz jahrelanger Freundschaft und gegenseitigem Respekt wird das erneute Aufeinandertreffen unausweichlich … Fazit Mit Friend kommt einmal mehr ein wuchtiger koreanischer Blockbuster ins Haus. Nicht ohne Grund wurde…