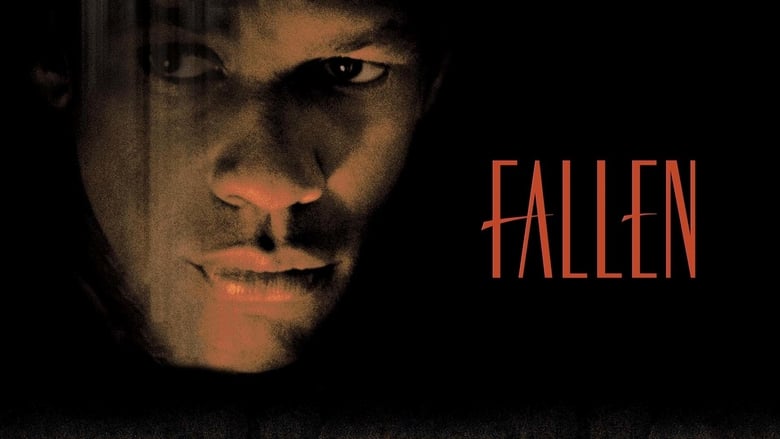-
Stranger Things – Staffel 1 – 5 (Gesamtreview)
Inhalt In der kleinen unscheinbaren Gemeinde Hawkings geht es nicht mit rechten Dingen zu und ausgerechnet eine Gruppe von Jugendlichen kommt diesem Treiben auf die Spur. Zunächst begann alles mit einem vermissten Freund und dann taucht ein mysteriöses Mädchen mit übernatürlichen Kräften auf… Fazit Der Hype um die fünfte und finale Staffel war dermaßen groß, dass ich noch einmal alle vorherigen Episoden (bis dato kannte ich auch nur Staffel 1 bis 3) gesichtet und mich nun zu einem kleinen Gesamtreview überwunden habe. Ich mochte schon immer das 80iger Jahre Retro-Szenario, doch gerade bei der ersten Staffel war mir die Darstellung noch ein wenig ungelenk. Man stieß den Zuschauer in jeder…
-
Rental Family
Inhalt Philip ist Schauspieler, der nach einer erfolgreichen Werbekampagne vor einigen Jahren im fernen Japan gestrandet ist und nun seit geraumer Zeit um seine Existenz kämpft. Eines Tages bekommt er von einem Bekannten ein dubioses Jobangebot, geht aber aus der Not heraus darauf ein. Er heuert bei einer Agentur an, die quasi Freunde, Familienväter oder sogar Ehemänner auf Zeit zur Verfügung stellt und so bei ihren Klienten bei Gefühlsfragen oder Familienangelegenheiten zur Seite stehen, versuchen etwas Freude zu verkaufen oder einfach als Sparringspartner herhalten… Fazit Das Jahr ist noch jung und schon habe ich am vergangenen Wochenende den ersten richtigen Kracher für 2026 (obwohl der Film ja streng genommen von…
-
Drive-Away Dolls
Inhalt Frisch nach der letzten Trennung begibt sich Jamie auf einen Roadtrip mit einer guten Freundin. Eigentlich wollten sie nur einen Wagen nach Tallahassee überführen und die dortige Verwandtschaft besuchen, doch plötzlich sind zwielichtige Gestalten hinter ihnen her… Fazit Am Anfang fühlte sich “Drive-Away Dolls” wie ein Unfall an – das Gebotene war irgendwie nicht sonderlich schön, aber irgendwie konnte man auch nicht wegschauen. Das Charakterdesign war schräg, die Inszenierung überraschend unkonventionell und geradeaus, also alles ein wenig gewöhnungsbedürftig. Die Geschichte war im Grunde recht einfach gestrickt und schon dutzende Male gesehen, doch dank einiger schräger Elemente erstaunlich frisch und irgendwie nicht so ganz vorherschaubar. Möglicherweise haben uns die Macher…
-
The Suspect – Traue Keinem
Inhalt Ein Spion und Auftragskiller als Nordkorea möchte endlich zur Ruhe kommen, in den Süden flüchten und die Reste seiner Familie ausfindig machen. Um seine ersten Schritte zu planen, heuert er als Chauffeur bei einem prominenten Politiker an. Als dieser jedoch ermordet wird, fällt der Verdacht schnell auf den neuen Angestellten und eine wilde Jagd beginnt… Fazit Ich hatte “The Suspect” bereits vor einigen Jahren gesehen und ihn leider auch etwas besser in Erinnerung gehabt. Für uns als ehemals ebenfalls geteilte Nation mag die Nord-Süd-Thematik sicherlich auch ihren Reiz ausüben, doch die recht trockene und teilweise auch arg zerfahrene Umsetzung tat dem Unterhaltungswert nicht gut. Irgendwie kam der Film nie…
-
Good Fortune – Ein ganz spezieller Schutzengel
Inhalt Schon seit einiger Zeit beobachtet Engel Gabriel den Menschen Arj und fühlt großes Mitleid für seine Pechsträhne. Eigentlich ist Gabriel für solche Fälle gar nicht zuständig, doch kurzerhand möchte er Arj zu einem besseren Leben verhelfen und macht mit seinem beherzten Einsatz alles noch viel schlimmer… Fazit Keanu Reeves geht eigentlich immer und wenn es diesmal um einen Schutzengel geht, wird der Film trotzdem geschaut. Nach dem Trailer hatte ich zwar keine allzu großen Erwartungen – aber die konnte das fertige Produkt immerhin ganz gut und vor allem symphytisch erfüllen. Die Geschichte riss keine Bäume aus – und entpuppte sich vor allem nach Sichtung der Vorschau als weder sonderlich…
-
Die große Flut
Inhalt Eine riesige Flutwelle überschwemmt das Land und rast auf den Wohnblock einer Wissenschaftlerin zu – die in voller Panik versucht, sich und ihren Sohn zu retten. Sie versuchen das rettende Dach des Gebäudes zu erreichen und erhalten dabei Unterstützung von einem mysteriösen Fremden, der scheinbar mit falschen Karten spielt und sich der Identität seiner “Mandantin” bewusst ist… Fazit Optisch famos und inhaltlich zumindest am Anfang noch relativ spannend. Mit “Die große Flut” hat Netflix einen interessanten, zum Ende hin allerdings auch recht verwirrenden Titel aus Südkorea am Start und mein Fazit fällt durchwachsen aus. Es hätte so schön werden können. Der Film steigt relativ früh ins nasse Geschehen ein…
-
House at the End of the Street
Inhalt Um nach der Scheidung ein neues Leben zu beginnen, ziehen Elissa und ihre Mutter in ein recht preiswertes Häuschen in einer kleinen Stadt. Über den ungewöhnlich niedrigen Preis wundern sie sich zunächst, erfahren jedoch schnell den Grund dafür: In der Nachbarschaft wurden vor einigen Jahren zwei Menschen von ihrer geistig verwirrten Tochter ermordet. Der überlebende Sohn lebt noch immer allein in dem Haus und wird von den übrigen Einwohnern gemieden. Einzig Elissa geht unvoreingenommen an die Sache heran und freundet sich mit dem seltsam schüchternen Jungen an … Fazit Nach ihrem endgültigen Durchbruch mit Die Tribute von Panem – The Hunger Games und dem Gewinn des Oscars ist Jennifer…
-
The Beast and the Beauty – Das Biest und die Schöne
Inhalt Hae-ju Jang ist ein blindes Mädchen, führt jedoch nicht zuletzt durch ihren Freund Dong-geon ein erfülltes Leben. Die beiden lernen sich zufällig kennen und werden schnell zu engen Freunden. Viele Stunden verbringen sie miteinander, und alles scheint harmonisch und glücklich. Hae-ju Jang ahnt jedoch nicht, dass Dong-geon nicht dem Bild eines klassischen Prinzen entspricht. Eine Narbe auf der Stirn zeichnet ihn, und auch sonst ist er alles andere als ein Frauenheld. Für beide stellt dies zunächst kein Problem dar – bis Hae-ju Jang kurz vor einer Operation steht, die ihr das Augenlicht schenken soll. Aus Scham über seine selbst eingeredete Hässlichkeit gibt sich Dong-geon plötzlich für einen anderen aus…
-
Oldboy
Inhalt Oh Dae-Su wird von Unbekannten scheinbar grundlos entführt und in einem Zimmer eingesperrt. Er hat keinen Schimmer, wer ihm dies angetan hat, und verbringt seine Tage einsam in einer trostlosen Umgebung. Sein Essen wird ihm geliefert, sogar sein Zimmer wird gereinigt – während er betäubt auf dem Boden liegt. Tag für Tag wächst sein Hass, und er beginnt zu trainieren. Eines Tages, nach nunmehr 15 Jahren, ist er plötzlich frei. Nun scheint die Zeit für Vergeltung gekommen zu sein, und er begibt sich auf die Suche nach seinen Peinigern. Doch die eigentliche Geschichte fängt gerade erst an … Fazit Oldboy überzeugt von Anfang an durch seinen gelungenen Spannungsaufbau. Die…
-
Friend
Inhalt Friend erzählt die Geschichte von vier Freunden aus Korea und davon, wie sie sich im Laufe der Jahre verändern. Wir lernen die Protagonisten zunächst als unbedarfte Kinder kennen, erleben ihre problematische Schulzeit und erkennen, wie stark ihre späteren Lebenswege bereits durch das Elternhaus geprägt werden. Mit zunehmendem Alter brechen die Kontakte ab, doch nach vielen Jahren kreuzen sich ihre Wege erneut. Ein Teil der Freunde hat sich dem kriminellen Milieu angeschlossen – allerdings stehen sie selbst dort nicht auf derselben Seite. Trotz jahrelanger Freundschaft und gegenseitigem Respekt wird das erneute Aufeinandertreffen unausweichlich … Fazit Mit Friend kommt einmal mehr ein wuchtiger koreanischer Blockbuster ins Haus. Nicht ohne Grund wurde…