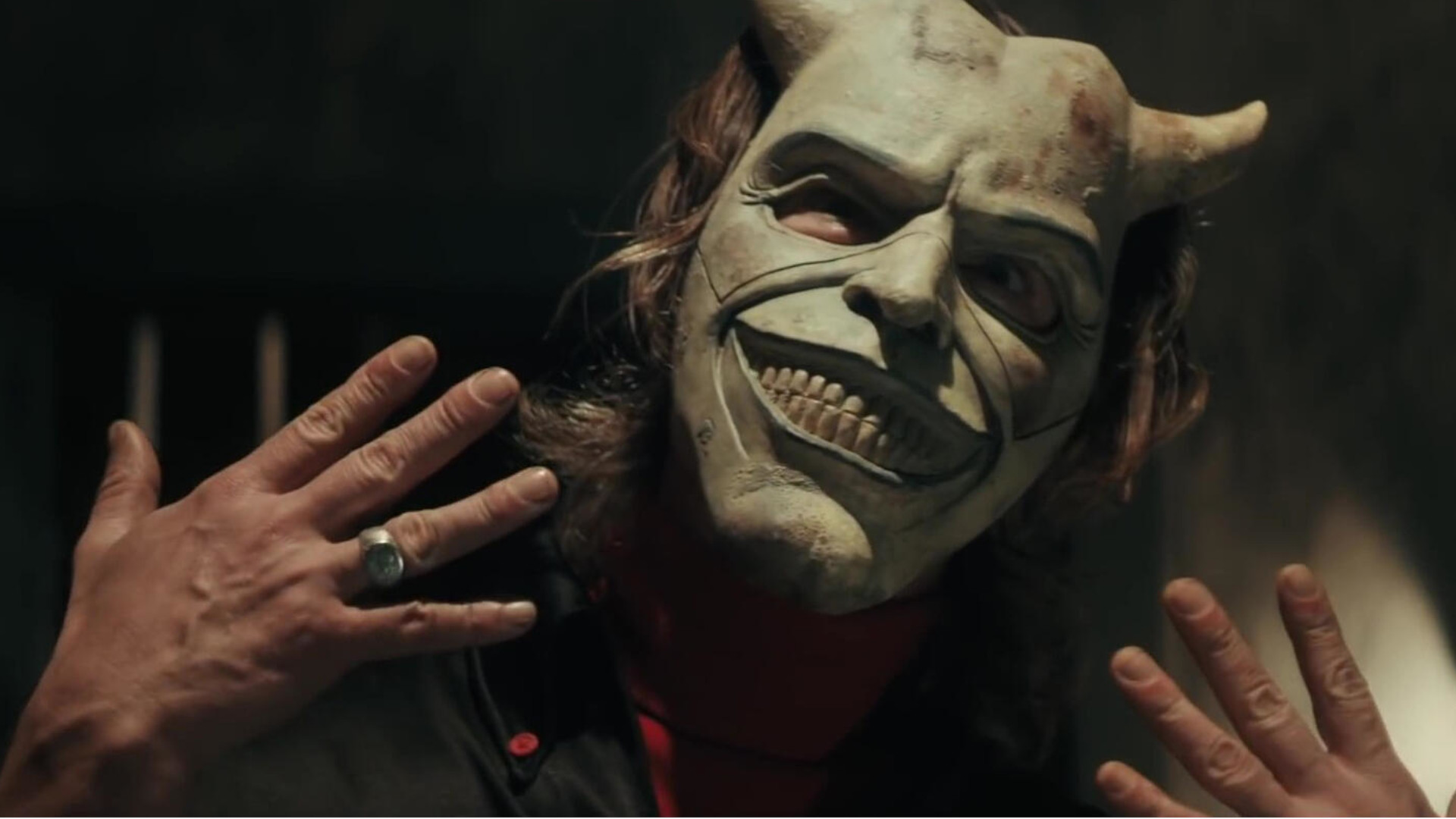-
Ice Road: Vengeance
Inhalt Um die Asche seines toten Bruder zu verstreuen, reist Mike ins ferne Nepal. Schnell gerät er am Zielort in einen Konflikt der Einheimischen und muss sich alsbald seinen Weg mit Waffengewalt freiballern… Fazit Bis kurz vor der gestrigen Sichtung wusste ich noch einmal, dass es Pläne für die Fortsetzung von The Ice Road gab. Dieser war in meinen Augen zwar damals ein recht solider Film – aber kein Kracher, der unbedingt einen weiteren Teil benötigt hätte. Immerhin setzt “Vengeance” nicht auf Vorkenntnisse und zeigte in nur wenigen Momenten leichte Parallelen zu seinem Vorgänger auf. Die Handlung war simpel und gradlinig, erinnerte mit ihrer wenig geistreichen Art an Streifen der…
-
Nobody 2
Inhalt Hutch braucht dringend Urlaub. Nachdem die Regierung seine Schulden bei den Russen beglichen hat, steht er in deren Schuld und erledigt einen drecken Job nach dem Anderen, steht langsam vor seiner Belastungsgrenze. Spontan packt er die Familie und fährt in den Freizeitpark seiner Kindheit – doch lange dauert der dortige Frieden nicht an und unser geschröpfter Held wird abermals in neue Konflikte hineingezogen… Fazit Nobody war seinerzeit ein echter Brecher und kam ein wenig aus dem Nichts. Eine Fortsetzung wurde (zumindest von mir) sehnlichst erwartet, doch am Ende kam nun ein zu erwartendes Ergebnis dabei heraus. Grundsätzlich war “Nobody 2” ein solider und vor allem sehr unterhaltsamer Film, dem…
-
Gears of War Reloaded (PC)
Inhalt Der Spieler schlüpft in die Rolle von Marcus Fenix, der von seinem Kameraden aus dem Gefängnis befreit wird und sogleich bei der Einhaltung einer Alien-Invasion behilflich sein muss… Gameplay “Gears of War” war seinerzeit vielleicht nicht der erste, aber zumindest der für mich am besten funktionierende Deckung-Shooter überhaupt. Ihr steuert eure bullige Hauptfigur aus der Third-Person-Perspektive durch gradlinig gestaltete Levelabschnitte, sucht bei der Konfrontation mit den Gegnern am besten schnell die Deckung und ballert aus sicherer Distanz. Lässt sich ein Nahkampf allerdings nicht vermeiden, darf dabei gerne die im Maschinengewehr integrierte Kettensäge zum Zuge kommen und kurzen Prozess mit den Feinden machen. Hin und wieder dürfen wir größere Geschützstellungen…
-
Cleaner (2025)
Inhalt Es ist kein guter Tag für Joanna. Ihr Bruder fliegt aus dem Heim, der Job steht auf der Kippe und zu allem Überfluss darf sie Überstunden während der Feier ihrer Firma schieben. Sie ist für das Putzen von Fenstern zuständig und muss dann allerdings von Außen einer Geiselnahme beiwohnen, doch kann als ehemalige Elite-Soldatin natürlich nicht tatenlos der Dinge verharren… Fazit Es war schon extrem “zusammenkonstruiert”, was uns bei “Cleaner” aufgetischt wurde und die offensichtlichen Vorbilder waren natürlich zu keiner Zeit von der Hand zu weisen. Richtig gut kupferte man dabei zwar leider nicht ab, für einen unterhaltsamen Abend taugte das Ding aber allemal. Während man die Geschichte im…
-
Batman: Arkham Asylum (PC, Nintendo Switch)
Inhalt Der Spieler schlüpft in die Rolle von Batman, der grade dabei ist, seinen Erzrivalen Joker in die Obhut des Arkham Asylum zu überführen. Die einfache Festnahme des Clowns machte ihn jedoch stutzig und erst in der Anstalt angekommen, offeriert sich der perfide Plan des Schurken… Gameplay Gespielt wird aus der Third-Person Perspektive und im “Metroidvania”-Stil, sprich: wir erkunden das weitläufige Gelände der Arkham-Anstalt, lernen neue Fähigkeiten und Gadgets kennen, können uns so durch zuvor nicht erreichbare Areale schlagen. Das Gameplay ist dabei aber trotzdem recht gradlinig, doch manchmal müssen wir uns zumindest zur Orientierung die integrierte Karte zur Hand nehmen. Neben Klettern, Schleichen und Kloppen gibt es hier und…
-
Das perfekte Verbrechen
Inhalt Der aufstrebende Anwalt Willy Beachum wird mit einem seltsamen Fall betraut. Er soll den wohlhabenden Ted Crawford für lange Zeit hinter Gittern bringen, doch im Laufe des Prozesses bricht die Beweiskette am versuchten Mord an dessen Frau vollkommen auseinander… Fazit Ein hochkarätiger Cast und eine grundsätzlich recht interessante Geschichte machen leider automatisch noch keinen allzu guten Film. Gerade mit seinem Finale (keine Spoiler!) verspielte sich der Titel ein paar wertvolle Punkte auf dem Weg zum Genre-Olymp. Mal abgesehen vom Ausgang haben die Autoren ein paar echt wendungsreiche Ideen eingebaut und damit vor allem dem nahezu diabolisch auftretenden Hopkins in die Hände gespielt. Er verkörperte den hochnäsigen Perfektionisten mit Hingabe…
-
What Happened to Monday?
Inhalt In einer Zukunft mit strikter “Ein-Kind-Politik” ist es nicht leicht für sieben Geschwister – die nach Wochentagen benannt wurden und sich nur an entsprechenden Tagen auf die Straße wagen. Siel teilen sich ein gemeinsames Leben und tauschen sich stets über ihre Erlebnisse aus. Als “Monday” jedoch am Montag nicht nach Hause kehrt, macht sich ein wenig Panik breit und das Familienteam macht sich auf die Suche… Fazit Ein großartiger Sci-Film im Stil von George Orwell oder einfach nur ein sagenhaft gutes Spiel von Noomie Rapace? In meinen Augen vereint dieser Streifen dies Beides und hinterließ am Ende einen hervorragenden Eindruck – selbst bei nunmehr wiederholter Sichtung. Die Geschichte hatte…
-
The Thursday Murder Club
Inhalt In der Seniorenresidenz Coopers Chase lässt sich ein entspannter Lebensabend verbringen, doch für einige Bewohner ist dies ein wenig zu langweilig. So gründeten Elizabeth Best, Ron Ritchie und Ibrahim Arif einen Club, der sich mit dem Lösen historischer Mordfälle beschäftigt. Kurz nachdem ein weiteres Mitglied zu ihnen stößt, geschieht jedoch ein Attentat direkt in ihrer Umgebung und so lassen sich die Hobby-Kriminologen nicht lange bitten… Fazit Im Zusammenhang mit diesem Film habe ich schon öfter die Bezeichnung “Cosy-Krimi” gehört und gelesen. Dies umschreibt das Geschehen letztlich auch recht gut – denn nicht mehr oder weniger hat uns Regisseur Chris Columbus hier bei Netflix abgeliefert. Es kam weniger auf großartige…
-
Sie leben
Inhalt Für Bauarbeiter John Nada ändert sich sein ganzes Leben, als ihm eine unscheinbare Sonnenbrille in die Hände fällt. Plötzlich erkennt er überall versteckte Botschaften und die Unterwanderung von außerirdischen Wesen… Fazit John Carpenter hat im Laufe seiner Kariere viele Kultstreifen abgeliefert und “Sie leben” gehört für mich definitiv zu seinen einprägsamsten Werken – welches nach knapp 40 Jahren nach seiner Erstveröffentlichung noch immer hervorragend funktioniert und dank aktueller HD-Auflage gestern Abend so frisch wie nie daher gekommen ist. Die Handlung war so simpel wie genial, die Darstellung einer unterwanderten Erde witzig und dennoch ernsthaft in Szene gesetzt. Der Film trieft voller Gesellschaftskritik, traf dabei stets die richtigen Töne und…
-
Atemlos – Gefährliche Wahrheit
Inhalt Für ein Schulprojekt muss Nathan Harper ein Referat über vermisste Menschen schreiben und stößt dabei auf einer Webseite auf ein Bild aus seiner Kindheit. Als er seine Eltern zur Rede stellt, stürmt auch schon ein Killerkommando das Haus und der Jugendliche begibt sich auf die Flucht… Fazit Taylor Lautner dürfte seinerzeit wegen “Twilight” in der Gunst des angestrebten Zielpublikums ganz oben gestanden haben, doch für mich als älteres Semester waren mit Sigourney Weaver, Mikael Nyqvist und Maria Bello auch ein paar Highlights in Sachen Darsteller zugegen. Obwohl der Streifen obendrein mit einer FSK12-Freigabe daher kam, ging es vergleichsweise actionreich und überaus ernst zur Sache. Die Handlung erfand zwar grundsätzlich…