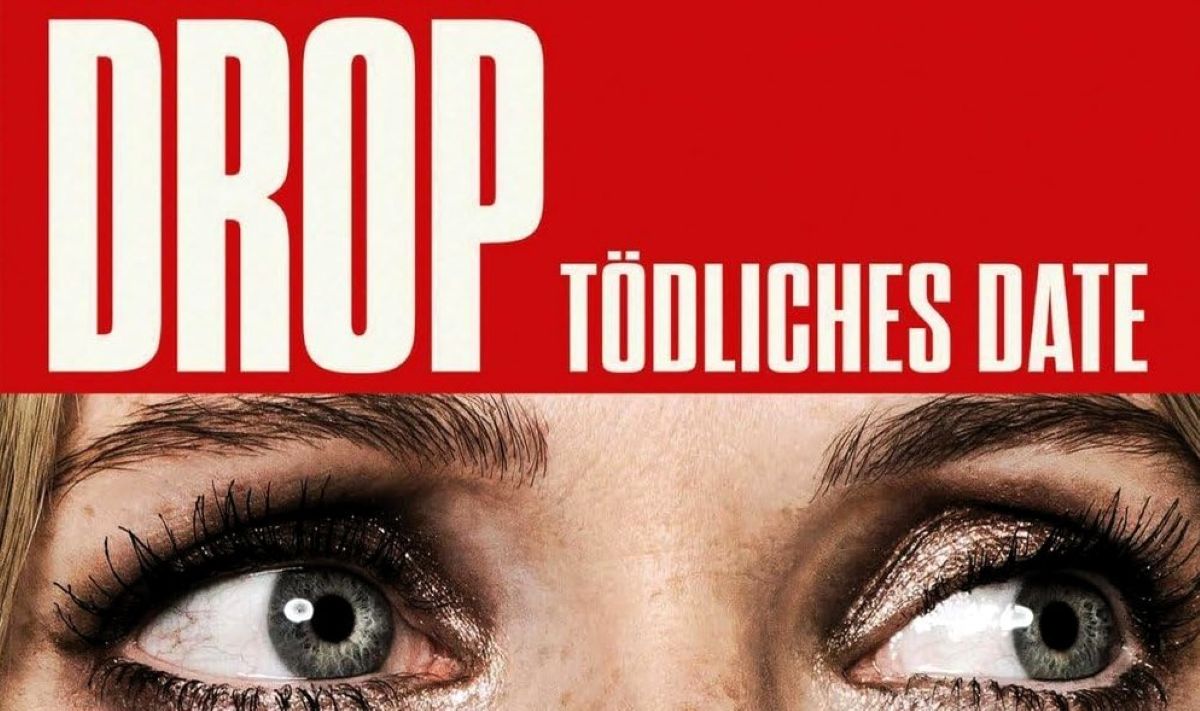-
Alien: Covenant
Inhalt Aufgrund eines Unfalls werden die Crew-Mitglieder der USCSS Covenant vorzeitig aus dem Kälteschlaf geweckt. Nachdem die Reparaturen abgeschlossen sind, empfangen sie plötzlich ein Signal von einem benachbarten Planeten. Eigentlich wollte man ein anderes System besiedeln, doch kurzerhand entscheidet man sich für einen Besuch der Signalquelle, die ebenfalls gute Atmosphären-Bedingungen bietet. Kaum angekommen, entwickelt sich der Trip zu einem echten Albtraum… Fazit Entgegen etlicher Kritiken empfand ich Prometheus als sehr gelungen und habe ihn schon etliche Male verschlungen. Sicherlich blieben bei diesem Werk viele Fragen offen – jedoch wurde direkt verkündet, dass weitere Teile geplant wären und die Geschichte im ersten Atemzug nicht vollends abgeschlossen sei. Alien: Covenant tritt nun…
-
Prometheus – Dunkle Zeichen
Inhalt Elizabeth Shaw und Charlie Holloway sind führende Archäologen und glauben, durch verschiedene Wandgemälde auf der ganzen Welt eine Brücke zu einer fernen Welt entdeckt zu haben. Sie vermuten, dass unsere Vorfahren bereits Kontakt zu außerirdischen Wesen hatten und wir ihnen möglicherweise den Ursprung unseres Lebens verdanken. Der alte und sehr gebrechliche Großindustrielle Peter Weyland erhofft sich Antworten auf viele Fragen und finanziert den Wissenschaftlern eine Expedition zu dem angepeilten Planeten. Völlig unklar ist jedoch, ob sie dort wirklich auf unsere „Konstrukteure“ oder auf gänzlich andere Dinge treffen werden… Fazit Nach vielen – zuweilen sehr mittelprächtigen – Sci-Fi-Filmen der letzten Jahre kehrt der Meister selbst zum Genre zurück und präsentiert…
-
Kull – Der Eroberer
Inhalt Ein mutiger Einsatz verhilft dem wilden Krieger Kull zum Platz auf dem Thron des Reiches. Rasch beginnt er viele Dinge anders als seine Vorgänger zu machen – und zieht damit den Zorn von seinen ausgebotenen Widersachern auf sich. Gemeinsam mit der bösen Hexe Akivasha wollen sie den Barbaren vernichten… Fazit Ein bisschen Fremdschämen war nie von der Hand zu weisen, doch immerhin kommen Fans von “Herkules” oder “Xena” schon irgendwo auf ihre Kosten. “Kull” war an sich kein besonders guter Streifen, fühlte sich aber wie eine technisch gehobene Doppel-Episode besagter Serien an und bot einen gewissen Unterhaltungswert. Im Vergleich zu den TV-Erzeugnissen wirkte alles einen Ticken aufwändiger und kinoreifer…
-
Karate Kid Legends
Inhalt Durch einen Jobwechsel der Mutter, ist Li Fong gezwungen mit Ihr nach New York zu gehen. Er versucht sich so gut wie möglich in der neuen Umgebung anzupassen, doch es dauert nicht lange, bis die Lage mit einem aggressiven Mitschüler eskaliert und die Herausforderung zu einem großen Kampf-Turnier ins Haus flattert… Fazit Als Kind habe ich die alten “Karate Kid”-Filme gerne geschaut, doch mittlerweile völlig aus den Augen verloren. Da deren letzten Sichtungen einfach zu lange zurück liegen, kann ich hier leider nicht wirklich auf Anspielungen oder Parallelen eingehen – der Neuauflage aber eine rundherum kurzweilige Unterhaltung bescheinigen. Mir gefiel der leicht körnige, blasse Look, der das Szenario von…
-
Conjuring 4: Das letzte Kapitel
Inhalt Aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen wollen die Warrens ein wenig kürzer treten und lehnen bereits diverse Aufträge ab. Als sich kurz nach einer Absage jedoch ein alter Freund erhängt, nehmen sie die Sache nun doch ernst und schauen sich den Fall einer scheinbar verwunschenen Familie etwas genauer an… Fazit Obwohl ich kein großer Fan von verwunschenen Häusern oder Grusel-Puppen bin, hat sich die “Conjuring”-Reihe einen kleinen Sonderstatus erarbeiten können. Die Filme (und deren Ableger) waren allesamt gut gemacht und vielleicht auch wegen ihrer wahren Hintergründe packend und nie zu Effekt-Erhaschend inszeniert. Die Erwartungen an “das letzte Kapitel” waren so durchaus hoch, doch nach dem Kinobesuch ging es mit gemischten Gefühlen nach…
-
Stephen King’s Es (1990)
Inhalt Aus traurigem Anlass treffen sich ein paar Freunde in ihrer alten Heimatstadt Derry wieder. Genau wie in ihrer Jugend sind Kinder verschwunden, und die Polizei steht vor einem großen Rätsel. Die Heimkehrer jedoch haben einen schlimmen Verdacht: Es ist zurück. Es ist ein geheimnisvolles Wesen, das sich zu ihren Kindertagen als Clown tarnte, die Gegend unsicher machte und grausam mordete. Gemeinsam konnten sie das Monster damals besiegen – doch nun, stolze 30 Jahre später, scheint es wieder aktiv zu sein… Fazit Nachdem ich mir vor ein paar Tagen erneut Dreamcatcher angeschaut und mich wieder über die schwache Charakterzeichnung geärgert habe, wollte ich mir diesmal ein gelungeneres Beispiel zu Gemüte…
-
Operation: Overlord
Inhalt Kurz vor dem berühmten D-Day soll eine kleine Spezialeinheit ein Störsignal ausschalten. Doch kurz vor ihrem Fallschirmabsprung stürzen sie ab, und nur ein Bruchteil der Gruppe findet sich lebendig wieder zusammen. Gemeinsam schlagen sie sich zu einem kleinen Dörfchen durch, in dem die Deutschen grausame Experimente an den französischen Einwohnern durchführen… Kritik Es gibt Filme, die man eigentlich sehr lieben möchte – aber manchmal springt der Funke einfach nicht so recht über. So erging es mir bei Overlord, der grundsätzlich alle Zutaten mitbrachte, letztlich aber nicht zu hundert Prozent überzeugen konnte. Schon zu Beginn sticht die grandiose Optik ins Auge, die alle bis dato erschienenen Kriegsfilme locker in den…
-
Das krumme Haus
Inhalt Ein junger Privatdetektiv wird von einer attraktiven Dame um Hilfe gebeten. Das wohlhabende Familienoberhaupt wurde ermordet, und jeder der gemeinsam unter einem Dach lebenden Angehörigen ist verdächtig. Sie fürchtet weiteres Unheil beim Kampf um das umfangreiche Erbe und holt den Ermittler quasi in die Höhle der Löwen… Fazit Romanadaptionen der Werke von Agatha Christie genießen schon lange Kultstatus, und ich finde es erstaunlich, dass es selbst in heutigen Zeiten noch vereinzelt Umsetzungen wie diese gibt. In bester Tradition tummeln sich auch hier wieder eine Menge bekannter Gesichter, die sich gegenseitig zur Höchstform anstacheln. Die Geschichte ist zwar relativ simpel und im Grunde wenig innovativ, aber trotzdem spannend und mit…
-
Under the Silver Lake
Inhalt Sam lebt in einer kleinen Wohnung in Hollywood und weiß kaum etwas mit sich anzufangen. Er beobachtet seine Nachbarn und verkehrt hin und wieder mit einer guten Freundin, doch einen tiefen Sinn sieht er in seinem Dasein wohl nicht. Als er jedoch das Geld für die Miete nicht mehr aufbringen kann und der Rauswurf droht, kommt ihm eine Belohnung in einem Vermisstenfall sehr recht. Sam wandelt durch verschiedene Locations der vermeintlichen Traumfabrik und wird während seiner Recherchen in seinen Grundfesten erschüttert… Fazit Wer auf die Bewertung schielt, erkennt, dass Under the Silver Lake nur knapp an der Höchstwertung vorbeigezogen ist – und dennoch absolute Pflicht für Filmfreunde sein sollte.…
-
Scarface
Inhalt Unter den vielen Flüchtlingen aus Kuba befindet sich auch Tony Montana, der sich dank eines verübten Auftragsmordes aus dem Lager freikämpft und fortan für einen Gangsterboss seine Dienste anbietet. Schnell steigt das ehrgeizige Narbengesicht auf, doch bald empfindet er die Denkweise seines Bosses als viel zu klein und er möchte dann selbst das Ruder übernehmen… Fazit “Scarface” ist die perfekte Anti-Parabel auf den amerikanischen Traum. Brian De Palma schilderte hier den (fiktiven) Aufstieg eines kleinen Einwanderers, der wirklich zum einfachen Tellerwäscher zum mächtigen Millionär aufgestiegen ist. In knappen drei Stunden wurde uns hier ein Brett serviert – welches über Jahre nachhaltig in Erinnerung blieb und sogar einen Teil der…